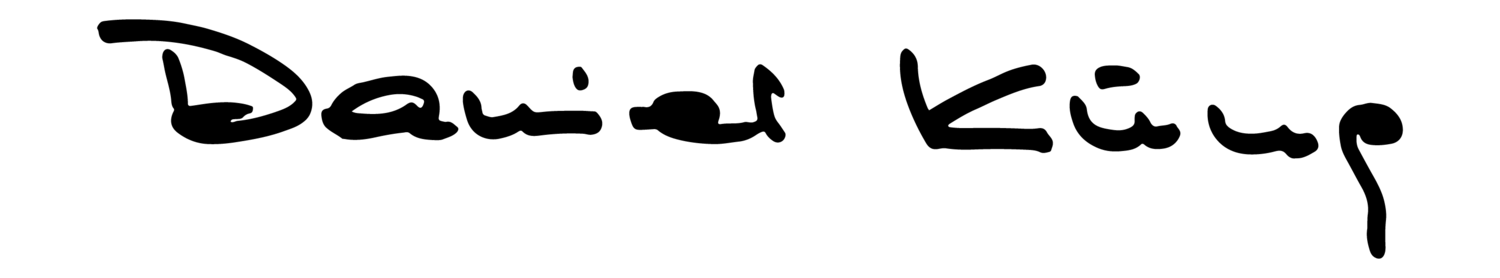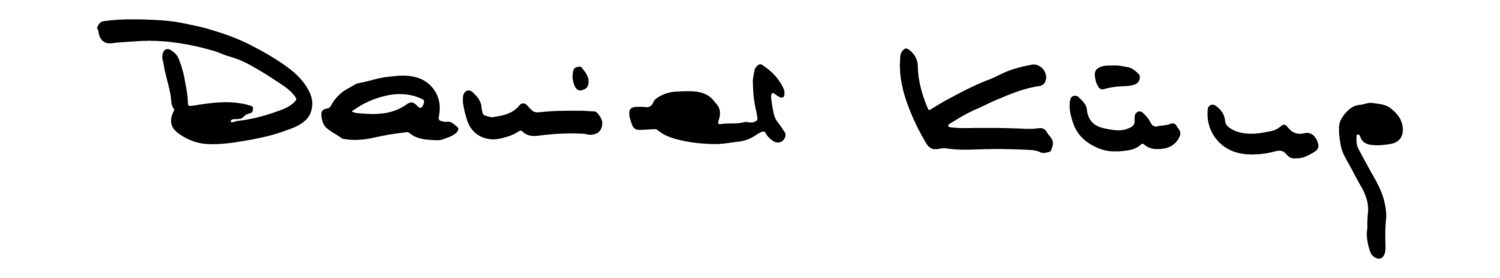«Der starke Franken tut den Schweizer Firmen mehr weh als der Handelskrieg»
Daniel Küng, oberster Wirtschaftsförderer der Schweiz, ist beunruhigt über die giftige Mischung von neuer Währungskrise, Brexit und Konjunkturabschwung. Er erwartet in der Schweiz mehr Arbeitslose und Firmenkonkurse.
Peter Burkhardt
Der Franken ist so stark wie seit Jahren nicht. Wiederholt sich das Schreckensszenario von 2012 und 2015, als viele Schweizer Exportfirmen in ernsthafte Schwierigkeiten gerieten?
Ich befürchte ja. Wir haben die gleichen Zutaten wie nach der Finanzkrise vor zehn Jahren. Es herrscht eine grosse Unsicherheit, wegen des Wirtschaftskriegs zwischen den USA und China, der instabileren geopolitischen Lage, des Brexit, der Argentinien- und der Irankrise. Gleichzeitig wird der konjunkturelle Rückgang spürbar, von China über Indien bis nach Deutschland und Grossbritannien. Die Unsicherheit schlägt auf die Währung durch. Es ist uns in den letzten zehn Jahren nicht gelungen, die Reservewährung Schweizer Franken von der Handelswährung Schweizer Franken zu entkoppeln. Das Risiko ist gross, dass wir erneut in eine schlimme Lage geraten.
Welche Auswirkungen erwarten Sie?
Die gleichen wie 2012 und 2015. Die Arbeitslosigkeit wird zunehmen, es wird mehr Firmenkonkurse geben. Fast noch schlimmer sind die längerfristigen Folgen: Mit dem wieder erstarkten Franken sinken die Margen. In der Folge können die Firmen weniger investieren. Damit sinken die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit. Das werden wir erst in drei, vier Jahren spüren.
Übertreiben Sie da nicht?
Leider nein. Im letzten Jahr büsste die Schweiz laut dem Weltwirtschaftsforum ihren Spitzenplatz als wettbewerbsfähigstes Land der Welt ein. Das war die logische Folge der Frankenkrise von 2015.
Der Handelskrieg, die Konjunkturflaute und die Frankenstärke ergeben eine giftige Mischung. Was davon trifft die Schweizer Exportfirmen am meisten?
Den Handelskrieg als solchen finde ich nicht so besorgniserregend. Verschiedene Studien besagen, er führe zu Wirtschaftseinbussen von zwischen drei und sechs Prozent - je nachdem, wie viele Länder noch aufspringen und ebenfalls Strafzölle erlassen. Das ist sicher erheblich, aber nicht katastrophal. Der Abschwung und der teure Franken tun den Schweizer Firmen viel mehr weh als der Handelskrieg.
Welche Branchen werden am meisten darunter leiden?
Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Die Anlagenbauer. Die Zulieferer der deutschen Autoindustrie. Und ganz allgemein Firmen, die stark auf den Euroraum ausgerichtet sind. Dort drückt der Schuh. Am wenigsten Sorgen machen müssen sich die Pharma- und die Chemieindustrie. Alle anderen wird es schmerzen.
Für wie gross halten Sie die Gefahr, dass die Konjunkturflaute in eine Weltwirtschaftskrise mündet und der Franken längere Zeit hart bleibt?Diese Gefahr ist gross, weil die Zentralbanken aufgrund der Tiefzinspolitik geringe Möglichkeiten haben, korrigierend einzugreifen.
Was können die Schweizer Firmen nun tun, angesichts des giftigen Cocktails?
Sie sollten versuchen, vom Handelskrieg zwischen China und den USA zu profitieren. Also schauen, wo sie einspringen können, wenn sich die beiden Länder gegenseitig blockieren. Und sie sollten ihr Risiko gegenüber dem Euroraum weiter vermindern, ihr Geschäft in anderen Märkten stärken. Das ist den Firmen schon nach der letzten Währungskrise bewusst geworden. Sonst wäre es nicht der Fall, dass nur noch 46 Prozent der Exporte in den Euroraum gehen und nicht 50 Prozent wie vor acht Jahren.
Ist die Schweiz auf den Abschwung gut vorbereitet?
Mehrheitlich stehen wir gut da. Die Firmen sind schlank, effizient, produktiv. Wir sind weit bei der Digitalisierung. Wir haben frühzeitig auf bilaterale Freihandelsabkommen gesetzt. Und wir haben frühzeitig die Weichen gestellt in Richtung neue Wachstumsmärkte. Wir waren über Jahre das europäische Land mit dem grössten Wachstum in Asien. Gleichzeitig haben wir die Exporte in die USA gestärkt. Vor 15 Jahren machten sie 9 Prozent aus. Jetzt sind es 16 Prozent. damit ist es uns gelungen, die Abhängigkeit von Europa zu verringern, sodass wir einen neuen Euroschock besser abfedern können.
Und auf der negativen Seite?
Aufgrund der Regulierungsdichte ist es schwieriger geworden, in der Schweiz zu geschäften und Unternehmen zu gründen. Im «Ease of Doing Business»-Index der Weltbank, der die Geschäftsfreundlichkeit beurteilt, ist die Schweiz innert 14 Jahren von Rang 11 auf Rang 38 zurückgefallen. Im «Time to Start a Business»-Index des Weltwirtschaftsforums liegt die Schweiz nur noch auf Rang 60. Zu denken geben muss uns auch, dass das Verhältnis zur EU schlechter geworden ist. Wir wären besser vorbereitet, wenn wir einen gesicherten Marktzugang zur EU hätten.
Den haben wir doch, dank der bilateralen Verträge.
Ja, aber er ist nur kurzfristig gesichert, nicht langfristig. Die Weiterentwicklung der Beziehung zur EU und sogar die bestehenden bilateralen Verträge werden politisch infrage gestellt. Das ist gefährlich, weil sich abzeichnet, dass es eine bipolare Welt geben wird, mit den USA und China als den beiden dominierenden Blöcken. Europa muss schauen, dass es nicht dazwischen aufgerieben wird, sondern seine Position als dritter Wirtschaftsblock halten kann.
Was heisst das für die Schweiz?
Die Schweiz muss darum besorgt sein, zu allen Blöcken geordnete und stabile Beziehungen aufzubauen, allen voran zu Europa. Faktisch sind wir Teil von Europa, wir liegen im Herz von Europa, wir sind wirtschaftlich verbunden mit Europa.
Sie plädieren also für den EU-Beitritt?
Das ist politisch nicht möglich. Ich rede nicht von Mitgliedschaft, sondern von einem nachhaltig gesicherten Zugang zur EU, den wir heute nicht haben.
Welche Folgen wird der Brexit - wenn er denn kommt - für die Schweizer Exporteure haben?
Er ist eher eine Chance als ein Risiko. Die Firmen, die Grossbritannien bisher vom europäischen Festland aus beliefern, beginnen nun, auf den britischen Inseln eigene, lokale Vertriebsorganisationen aufzubauen.
Wie schlimm wäre es, wenn das neue Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay von den Kritikern gebodigt würde?
Es wäre schade und eine vertane Chance, denn bei Mercosur reden wir von über 180 Millionen Franken Zolleinsparungen pro Jahr. Das ist ein schöner Betrag, aber das alleine macht die Sau nicht fett.
Welche wichtigen Freihandelsabkommen fehlen noch?
Das wichtigste wären die USA, dann Indien und Malaysia. Damit hätten wir die grössten Märkte abgedeckt. Australien wäre wünschbar, das würde uns einen noch wenig bearbeiteten Markt eröffnen.
Der Ständerat berät am Mittwoch einen Antrag seiner Wirtschaftskommission, S-GE 94 Millionen Franken mehr zu geben. Warum ist das nötig?
Die Firmen sind wegen des Handelskriegs, des Brexit, des starken Frankens und der Konjunkturabschwächung verunsichert und brauchen mehr Unterstützung. Hierfür müssen wir aufrüsten. 2017 liessen sich 4400 Firmen von uns beraten. Dieses Jahr werden es gut 5200 sein.
Sie treten Ende September in den Ruhestand. Was sind Ihre persönlichen Pläne?
Sicher nicht der Ruhestand. Ich möchte meine Erfahrungen, die ich als Firmengründer, Unternehmer und zuletzt als Chef von S-GE gesammelt habe, in irgendeiner Art weitergeben und weiterhin Neues dazulernen. In welcher Form und für welche Firmen, steht noch nicht abschliessend fest.
Der Exportförderer
Der Volks- und Betriebswirt Daniel Küng, 66, ist seit 15 Jahren Direktor der Aussenwirtschaftsförderungsorganisation Switzerland Global Enterprise (S-GE). Diese unterstützt im Auftrag des Bundes die Exportgeschäfte von Schweizer KMU und kümmert sich um die nationale Standortpromotion sowie die Importförderung. Präsidentin ist Alt-Bundesrätin Ruth Metzler. Finanziert wird die Organisation vom Bund, den Kantonen und über 2000 Mitgliederfirmen. Ende September tritt Küng in den Ruhestand.
Quelle: https://epaper.sonntagszeitung.ch/#article/10000/SonntagsZeitung/2019-09-08/42/100360645